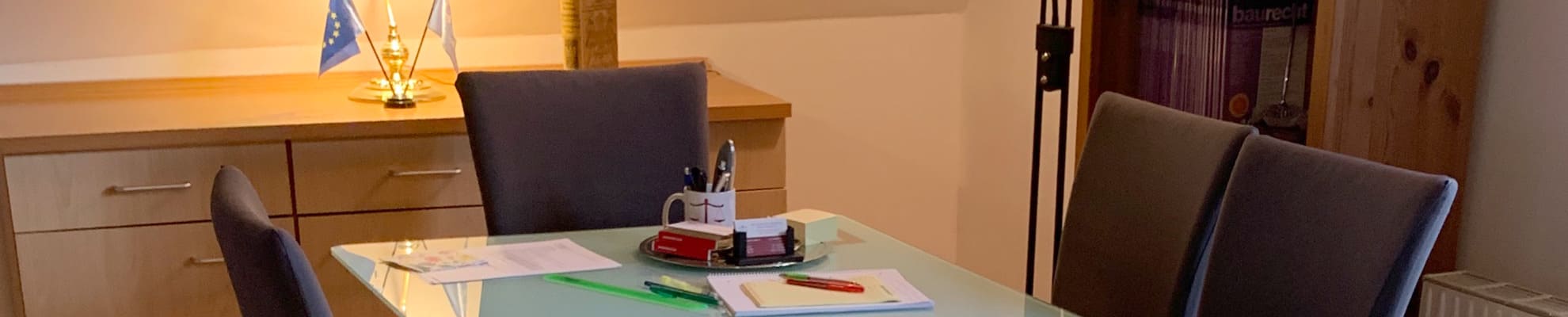27.06.23
§650a BGB - wesentliche Grundgedanken der gesetzlichen Regelung v.a. in Bezug auf §307 BGB:
- Interessensausgleich zwischen beide Parteien = Art. 12 IGG
- Zumutbarkeit der Änderung durch vorgeschriebene --> Verhandlungsphase
- Vorrang des Konsensprinzips vor einseitiger Anordnung
- §650b, Abs. 1, S. 1 Nr. 2 BGB:
Typischer Fall: Fehlerhafte Leistungsbeschreibung
- Möglichkeit der vergütungsrechtlichen Regelung in Kombination mit Recht des Bestellers zur Entscheidung über die
Behebung der fehlerhaften Leistungsbeschreibung
- Streben nach Einigung
- Kooperationsverpflichtung
- §650a Abs. 1 S.1 = gesetzliche Ausprägung grundlegender und wesentlicher Verpflichtungen der Bauvertragsparteien
- Pflicht zum Streben nach Einigkeit
- Pflicht zur Vorlage einer geänderten Planung durch Besteller, soweit der Besteller die Planungsverantwortung für
den zu ändernden Leistungsinhalt trägt und Planungsrisiko des Bestellers, wenn dieser die Planung vorgibt
- Zumutbarkeit der willkürlichen Änderung
- Grenzen der Änderungsbefugnis bei dem Einigungsgrundsatz = Einigungsgrundsatz ist der Anordnung vorgeschaltet
- Änderungsrecht bei notwendigen Änderungen, auch bei funktional nicht geeigneten Leistungsbeschreibungen kann
Besteller Änderungsanordnungen treffen, da er die Änderungen auch bezahlen muss
- Entscheidung über notwendige Änderung verbleibt beim Besteller = Grundgedanke der gesetzlichen Regelung!
- Notwendigkeit der Änderung = §650b I, Satz 1, Nr. 2
- wenn nicht notwendig, alle anderen willkürlichen Anordnungen sind §650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB zuzuordnen – hier
zusätzlich AGB-rechtl. Leitbild der Zumutbarkeit, durch den Auftragnehmer geschützt wird
- Leistungen, die (nur) zur Herbeiführung des Werkerfolgs notwendig werden, erhalten eine Anpassung der Vergütung,
soweit die Auslegung des Bauvertrags ergibt, dass sich die Vergütung nur auf die in der -ursprünglichen-
Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen bezieht
- Äquavilenz von Leistung und Gegenleistung!
-> Verstöße gegen diesen Grundgedanken in AGB-Klauseln sind unwirksam!
- 30- Tagefrist - §650b, Abs. 2 BGB:
wesentlicher Grundgedanke: 30 Tage sind Obergrenze
- Textform - §650b, Abs. 2 BGB:
wesentlich, damit wohl gesetzliches Leitbild
- „Kann“ – Regelung des §650b, Abs. 2 BGB:
gehört nicht zum gesetzlichen Leitbild
Vereinbarkeit einzelner Klauseln in ABGs des Verwenders von Musterbauverträgen
- unwirksam: Ausschluss der Verpflichtung des AG
-> Einvernehmen über die Mehr- oder Mindervergütung anstreben
- unwirksam: vollständiger Ausschluss des §650b BGB
- wirksam: Modifikation der Verhandlungsphase
- unwirksam, wenn Unternehmer Verwender:
-> Änderung nur mit Änderungsvereinbarung möglich
- 30-Tagesfrist:
-> u.U. wirksam: unmittelbar ausübbares Änderungsrecht nur bei wichtigen Gründen für Verwender
-> Unaufschiebbarkeit von Anordnungen: wirksam, Vereinbarung
keine 30-Tagefrist für Verhandlungen vorzuschalten vor Anordnung
-> wirksam: AGB, wonach 30-Tagefrist vor Anordnung nicht erforderlich ist,
wenn Unternehmer die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert
-> u.U. unwirksam: Abweichung von 30-Tagefrist bei Geringfügigkeit der auszuführenden Änderung
-> verlängerbar in AGB für Fall, daß Besteller Verhandlungen ernsthaft und endgültig verweigert,
ansonsten wohl nicht verlängerbar
-> verlängerbar aber für den Fall, daß die Ermittlung der Mehrkosten und anschließende Verhandlung
innerhalb der gesetzlichen Frist nicht möglich ist
ABER: Vorrangig ist das Beschleunigungsinteresse des Bestellers
- AGB-Klausel unwirksam, wonach der Unternehmer die für ein mangelfreies und voll funktionstaugliches Bauwerk
erforderlichen Änderungsleistungen ohne Vorlage einer Änderungsplanung durch den Besteller vorzunehmen hat -
wenn Besteller für die Planung verantwortlich ist. -> würde dem gesetzlichen Leitbild der Fortgeltung der
vertraglichen Verteilung der Planungsverantwortung auch für die erforderlichen Änderungen widersprechen.
- bei geteilter Planungsverantwortung:
Besteller Entwurfsplanung – Unternehmer Ausführungsplanung =
jede Partei ist für ihre Planung für ihren Teil verantwortlich
- Vorlage eines Angebots nach § 650b I, 2 BGB =
gesetzliches Leitbild -> kann in AGB des Unternehmers nicht ausgeschlossen werden
- Angebot des Unternehmers darf auch überhöht sein bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit
- AGB-Klausel unwirksam, wonach der Unternehmer für Angebotserstellung Entschädigung erhält
- Bauablauf und Bauzeit: AGB-Klauseln des Bestellers möglich, wenn Dispositionsfreiheit des Unternehmers genügend
berücksichtigt wird
Quelle: „baurecht“, Sonderheft 4a 2023
Teilkündigung im VOB/B-Vertrag
Das OLG Düsseldorf (Urteil v. 08.12.2022 – 5 U 232/21) hatte über folgenden Fall zu entscheiden: Der (öffentliche) Auftraggeber gab den Auftrag, ein neues Justizzentrum, bestehend aus Bauteilen A-F zu errichten. Nachdem die Bauleistungen in Bauteilen A-E ausgeführt waren, rügte der Auftraggeber einige Mängel in den bereits ausgeführten Bauteilen und kündigte den VOB/B-Bauvertrag gem. § 8, Absatz 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B hinsichtlich der noch aus-stehenden Dachabdichtungsarbeiten im Bauteil F.
Die Auftragnehmerin bestritt die Wirksamkeit dieser Kündigung. Im anschließenden Rechtsstreit darüber entschieden sowohl das Landgericht Düsseldorf, als auch das Oberlandesgericht Düsseldorf, dass diese Kündigung unwirksam war. Dies begründeten die Gerichte mit Folgendem: Eine Teilkündigung nach § 8 VOB/B ist nur dann zulässig, wenn die Kündigung sich auf einen in sich abgeschlossenen Teil bezieht. Leistungsteile innerhalb eines Gewerks (wie hier die Dachabdichtung in Bauteil F sind grundsätzlich nicht als abgeschlossen anzusehen, da ihnen die Selbständigkeit mangelt. Nur eigenständige Teilleistungen sind einer Kündigungsmöglichkeit nach § 8, Absatz 3 Nr. 1, Satz 2 VOB/B zugänglich.
Anmerkung hierzu: Es bleibt abzuwarten, ob der genannte Passus des § 8 Absatz 3 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einer AGB.Kontrolle nach § 307 BGB standhält, da die Möglichkeiten einer Teilkündigung nach VOB/B im Verhältnis zu § 648a, Absatz 2 BGB (in seiner Form seit 1.1.2018) strengere Anforderungen stellt als die vergleichbare gesetzliche Leitklausel.
Materialpreissteigerungen während des Vertragsablaufs – welche Ansprüche hat der Auftragnehmer?
In Zeiten der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie, sowie auch nach einem Jahr des kriegerischen Angriffs Russlands auf die Ukraine lassen sich die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaftsflüsse nicht mehr wegdiskutieren. Die damit zusammenhängende Verknappung zahlreicher Baumaterialien und Verzögerungen in den Lieferketten haben massive Auswirkungen in Form von erheblichen Preissteigerungen.
In Bauverträgen ist es üblich, die für die Ausführung benötigten Materialien nicht auf Vorrat einzukaufen, sondern den mehr oder weniger geschätzten Kalkulationspreis in den Angebotspreis einzubringen. Wenn sich nach Vertragsschluss die Materialpreise erheblich steigern, müssen Wege gefunden werden, einen fairen Ausgleich für die Materialpreis-steigerungen zu erhalten. Denn andernfalls kann es vorkommen, dass nicht nur der kalkulierte Gewinn durch die Preissteigerung aufgezehrt wird und der Vertrag damit nicht mehr auskömmlich ist, sondern dass aus einem zuerst gut kalkulierten Vertrag ein Verlustgeschäft wird.
Die Möglichkeiten, die ein Auftragnehmer in einer solchen Situation hat, sind leider durchaus begrenzt und hängen in ihrer Stärke von einer Einzelfallbetrachtung ab.
Für alle diesbezüglichen Fälle gilt jedoch der Grundsatz: Der Unternehmer/Auftragnehmer trägt das Kalkulations-risiko, das heißt er steht dafür ein, dass der von ihm angebotene und dann zum Vertragspreis gewordene Preis für ihn auskömmlich ist. Dieses Kalkulationsrisiko wendet sich nicht in eine automatische Nachschusspflicht des Auftraggebers, wenn sich die Preise erhöhen, egal ob die Erhöhung „normal“ und vorhersehbar war, oder ob die Erhöhung unvorhersehbar war.
Daher ist dem Auftragnehmer die folgende Vorgehensweise anzuraten:
1. Enthält der abgeschlossene Vertrag ohnehin eine Regelung, wie bei Preissteigerungen zwischen den Parteien verfahren wird?
2. Enthält der abgeschlossene Vertrag nicht ohnehin eine „Preisgleitklausel“ für verschiedene für die Vertrags-ausführung anzuschaffende Materialien?
3. Enthält der abgeschlossene Vertrag nicht ohnehin eine „Force Majeure“-Klausel, also eine Klausel, die vorgibt, wie in Fällen von höherer Gewalt umzugehen ist? Dies sollte tatsächlich untersucht werden durch den Auftrag-nehmer, denn auf Grundlage neuerer Rechtsprechung (z.B. BGH-Urteil vom 12.01.2022 – VII ZR 172/86) wird sowohl die Covid-19-Pandemie, als auch der Ukraine-Krieg als Ereignisse der höheren Gewalt angesehen, wobei nicht nur diese Ereignisse selbst der höheren Gewalt zugerechnet werden, sondern auch die durch diese Ereignisse mittelbar ausgelösten Ereignisse.
4. Auch wenn die Punkte 1. – 3. sich nicht unmittelbar aus dem abgeschlossenen Vertrag ohne weiteres ergeben, ist in jedem Fall bei einem VOB/B-Vertrag dem Auftragnehmer anzuraten zu prüfen, ob für den speziellen Fall § 6, Abs. 1 VOB/B anwendbar ist, der in weiterer Anwendung des § 6, Abs. 2 VOB/B wiederum auf Grundlage der Annahme eines Falls der höheren Gewalt zu einer – durch den Auftragnehmer vorher schriftlich anzuzeigenden! – Behinderung und damit zu einer Verlängerung der Ausführungsfristen führen kann.
5. Soweit ein Fall der höheren Gewalt angenommen werden kann und vertragliche diesbezügliche Vereinbarungen fehlen, ist der Weg zum nächsten Schritt nicht weit, nämlich die Prüfung, ob durch diesen Fall der höheren Gewalt auch eine Störung der Geschäftsgrundlage - § 313 BGB – vorliegen könnte.
Hierbei ist jedoch zu beachten: Eine Störung der Geschäftsgrundlage ist immer nur denkbar, wenn die gemeinsame Geschäftsgrundlage gestört ist – und daran scheitern leider zahlreiche Anspruchsforderungen von Auftragnehmern. Es reicht nämlich nicht aus, wenn nur die Geschäftsgrundlage, auf die der Auftragnehmer sein Angebot kalkuliert hat (also Preisgrundlage, Markterforschung, Kalkulationserwägungen). Sondern es muss die gemeinsame Geschäftsgrundlage nachhaltig und schwerwiegend gestört sein. Zur gemeinsamen Geschäftsgrundlage zählen z.B. gemeinsame grundlegende Erwartungen der Parteien, was die die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen sind, und dass diese gerade nicht durch Naturkatastrophen oder Kriegszustände massiv erschüttert werden.
Solche besonderen Umstände dürfen auch erst nach Vertragsschluss aufgetreten sein, um eine Störung der Geschäfts-grundlage bejahen zu können. Denn andernfalls konnte der Auftragnehmer die Umstände ja schon bei seiner Kalkulation berücksichtigen.
Die besonderen Umstände müssen letztlich auch so massiv störend sein, dass ein Festhalten an den Vertrags-vereinbarungen in unveränderter Form nicht mehr zumutbar ist.
6. Sind all die unter 5. grob umrissenen Voraussetzung erfüllt, besteht für den Unternehmer/Auftragnehmer Anspruch auf Vertragsanpassung.
Durch den Auftragnehmer kann leider nicht erwartet werden, dass die Höhe der Anpassung gleich der Material-preissteigerung ist. Nach der Rechtsprechung des BGH stellt eine hälftige Teilung der Kosten der veränderten Umstände eine interessensgerechte Lösung dar.
Auch wird der Unternehmer/Auftragnehmer nicht damit rechnen können, die neben den tatsächlichen Material-preissteigerungen erhöhten Zuschläge für Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, sowie Wagnis und Gewinn ersetzt zu bekommen.
Dies wäre möglich im Rahmen des § 650c BGB (also im Rahmen einer Anordnungsänderung des Auftraggebers), nicht aber, wenn als einzige Anspruchsgrundlage für die Mehrkostenforderung § 313 BGB übrig bleibt.
Die Thematik der Materialpreissteigerungen bei laufenden Verträgen ist vielfältig und immer einzelfallabhängig. Für weitergehende Details hierzu wird auf den lesenswerten Aufsatz in der Zeitschrift „baurecht“ 2023, S. 139 – 147 von Frau Rechtsanwältin Prof. Dr. Iris Oberhauser, sowie auf das Rundschreiben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom 25.03.2022 – BW17-70437/9#4 hingewiesen.
Notwendige Mitwirkungshandlung des Auftraggebers für Nachbesserung
Wie in einem Verfahren des OLG Nürnberg – 6 U 4362/19 v. 23.11.2021 – entschieden wurde, kann eine fehlende Mitwirkung des Auftraggebers zur Wirkungslosigkeit der Mängelrüge führen.
So war der Fall: Dem Auftragnehmer war eine Glasfassade beauftragt worden, die neben anderen Mängeln auch eine erhöhte Kondensatbildung auf der Innenseite der Fassade aufwies. Der Auftraggeber erhob Mängelrüge und verlangte Rückbau der Fassade und Neuerrichtung der Fassade ohne Kondensatbildung.
Durch den Auftragnehmer konnte nachgewiesen werden, dass er bei der Ausführung seiner Prüf- und Hinweispflicht (§13 III VOB/B) nachgekommen war und den Auftraggeber schon während der Ausführungszeit darauf hingewiesen hatte, dass aufgrund der vom Auftraggeber gestellten und vertraglich auch vom Auftraggeber geschuldeten Planung die Gefahr einer Kondensatbildung bestand. Trotz der auftragnehmerseitigen Hinweise wurde keine andere Planung durch den Auftraggeber gestellt, so dass der Auftragnehmer entsprechend dieser Planung die Fassade errichtete.
Das Gericht entschied als letzte Instanz, hier den Vorinstanzen folgend, dass die Aufforderung des Auftraggebers zur Mängelbeseitigung in Bezug auf die Kondensatbildung an der Innenseite der Fassade „derzeit“ nicht fällig war, da der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht zur Stellung einer fachgerechten Planung nicht nachgekommen war.
Das Gericht stellte jedoch auch fest, dass die Fassade wegen der Kondensatbildung mangelhaft durch den Auftragnehmer errichtet worden war.
Anmerkung: Diese Entscheidung verdeutlicht die Wichtigkeit der Prüf- und Hinweispflicht. Nur wenn die erforderlichen Hinweise in der Dokumentation des Aufnahmers beweisbar darstellbar sind, kann der Auftragnehmer frei werden von seiner ansonsten bestehenden Mangelhaftung.
Der Fall stellt auch die bittere Wahrheit klar, dass der Auftragnehmer grundsätzlich immer ein funktionstaugliches Werk schuldet. Ein – verschuldensunabhängiger! – Mangel liegt auch dann vor, wenn der Mangel des Werks nicht auf der Ausführungsweise des Werkvertrags-Unternehmer beruht. Nur der Prüfhinweis des Auftragnehmers kann diesen vor dem Einstehen für den Mangel schützen.
Für den Auftragnehmer gut zu wissen: Die Folge einer unterlassenen erforderlichen Mitwirkung des Auftraggebers führt zur Wirkungslosigkeit der Aufforderung des Auftraggebers zur Mängelbeseitigung. Daher Achtung: Nicht versehentlich die Planungsverantwortung durch technische Hilfe übernehmen, wenn die Planung ursprünglich dem Auftraggeber oblag.
nochmals zur notwendigen Mitwirkungshandlung des Auftraggebers bei der Nachbesserung/Mängelbeseitigung
Die Frage, ob zur Mängelbeseitigung eine Mitwirkungshandlung des Auftraggebers erfordert und ohne diese die Mängelbeseitigungsaufforderung des Auftraggebers wirkungslos sein kann, ist - wie so vieles im Baurecht – nicht unumstritten.
Nicht vergessen werden darf dabei die „Symptomtheorie“ des Bundesgerichtshofs, nach der es ausreicht für eine wirksame Aufforderung zur Mängelbeseitigung, wenn der Auftraggeber nur ein Symptom des Mangels beschreibt, und der Auftragnehmer nach dieser auftraggeberseitigen Symptombeschreibung gefordert ist, die Grundlagen des Mangels ausfindig zu machen und diesen zu beheben.
Nach Meinung in Rechtsprechung und Literatur kommt es bei solchen Sachverhalten stets auf die Komponente einer offensichtlichen Notwendigkeit der auftraggeberseitigen Mitwirkung zur Mängelbehebung an, die der Auftragnehmer nach Treu und Glauben durch Ausübung seiner Hinweis- und Bedenkenanzeigen einfordern muss.
Nur durch das Zusammenspiel zwischen Notwendigkeit der Mitwirkungspflicht des Auftraggebers und der Ausübung der Hinweis- und Bedenkenanzeigen kann es ausnahmsweise zum Freikommen von der Mangelhaftung kommen.
Mangelhaftung im Baurecht ist verschuldensunabhängig!
Die Gewährleistung des Auftragnehmers/Unternehmers ist stets verschuldensunanhängig. Hierzu wies das Kammergericht Berlin nochmals in seinem Beschluss vom 28.09.2021 hin - AZ 27 U 12/21 -.
Das Gericht stellte in dieser Entscheidung fest und bestätigte damit Gesetz und ständige Rechtsprechung:
Ein Mangel des geschuldeten Werks ist auch ohne Verschulden des Auftragnehmers aufgrund fehlender Erkennbarkeit der Ursache des Mangels vertragswidrig und löst damit grundsätzlich Gewährleistungsansprüche aus.
Bedeutet also: Haftet dem Werk ein Mangel an, ist der Auftragnehmer zur Mängelbeseitigung und Nachbesserung verpflichtet. Auf ein Verschulden für den Mangel kommt es nicht an.
Von dieser Gewährleistungspflicht und damit zusammenhängender Haftung kann sich der Auftragnehmer nur ausnahmsweise befreien (Stichwort: Hinweis- und Bedenkensanzeige; Stichwort: notwendige Mitwirkung des Auftraggebers).
Veranstaltung von Webinaren
Informationen über unsere kommenden Webinare erhalten Sie hier.
Veranstaltung von Seminaren
Informationen über unsere Seminare erhalten Sie hier. Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Corona-Covid-Pandemie sind von uns momentan keine Präsenz-Seminare geplant.